Die Lebenserwartung der Menschen steigt. Doch mit zunehmendem Alter erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir unter chronischen Krankheiten leiden oder mehrere Erkrankungen auf einmal haben. Viele Senior:innen müssen regelmäßig fünf oder mehr Arzneimittel einnehmen. Die Medizin spricht von Polypharmazie. Laut Österreichischer Apothekerkammer sind mehr als eine halbe Million Menschen über 60 Jahre in Österreich betroffen.
Risiko für unerwünschte Wirkungen steigt
Mit jedem Medikament, das zusätzlich eingenommen wird, steigt jedoch das Risiko für unerwünschte Wirkungen. Auch mögliche Wechselwirkungen zwischen den Wirkstoffen untereinander beziehungsweise zwischen Wirkstoffen und bestimmten Nahrungsmitteln (siehe Wechselwirkungen: Wie unsere Ernährung die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflusst) sind ein Problem.
Altersbedingte Veränderungen
Hinzu kommt, dass auch der Alterungsprozess des Körpers Auswirkungen auf die Verträglichkeit von Medikamenten hat. So ist der Magen bei älteren Menschen träger und die Wirkstoffe gelangen nicht mehr so rasch in den Darm und somit in den Blutkreislauf.
Auch nimmt mit zunehmendem Alter der Körperwasseranteil ab, während der Körperfettanteil steigt. Medikamente, die sich im Fettgewebe anreichern, wirken daher länger und bei wasserlöslichen Medikamenten werden rascher höhere Wirkstoffspiegel erreicht. Zudem kann die Verringerung der Muskelmasse zu einer Veränderung der Wirkstoffverteilung führen.
Da Leber- und Nierenfunktion bei älteren Menschen abnehmen, können sich manche Wirkstoffe rascher anreichern, insbesondere, wenn krankhafte Organveränderungen, wie etwa eine Herzschwäche, auftreten. In diesen Fällen ist nach ärztlicher Rücksprache eine Dosisreduktion angezeigt.

Symptome falsch interpretiert
Die körperlichen Veränderungen führen dazu, dass manche Arzneistoffe für ältere Menschen weniger geeignet sind als andere. Die Folgen können gravierend sein. Verschärfend kommt hinzu, dass typische Symptome für unerwünschte Arzneimittelwirkungen wie Schwindel, Verwirrung, Schwierigkeiten beim Denken und erhöhte Sturzgefahr oft als alterstypische Beschwerden abgetan werden.
Für Ärzt:innen und Apotheker:innen ist es deshalb umso wichtiger zu wissen, welche Medikamente für ältere Menschen eine besondere Gefahr darstellen und deshalb möglichst nicht verabreicht werden sollten. Auch für Senior:innen selbst und Angehörige ist es vorteilhaft, darüber Bescheid zu wissen.
Wie real die Gefahr ist, ist dem österreichischen Gesundheitsbericht entnehmbar. Demnach haben im Jahr 2020 hierzulande 37 Prozent der über 70-Jährigen mindestens eine potenziell inadäquate Medikation erhalten.
PRISCUS-Liste
Doch wie kann ich wissen, bei welchen Mitteln Vorsicht geboten ist, wenn ich im fortgeschrittenen Alter bin? Auskunft sollte in Österreich die sogenannte PIM-Liste geben. Das Kürzel PIM steht für „potenziell inadäquate Medikation“.
Da der Medikamentenmarkt auch innerhalb der Europäischen Union von Land zu Land zahlreiche Unterschiede aufweist, bedarf es einer entsprechend spezifischen Herangehensweise. Die PIM-Liste wurde im Jahr 2012 auf Basis der äquivalenten deutschen PRISCUS-Liste erstellt. Sie wurde allerdings seither nicht mehr angepasst. Deshalb haben wir die PRISCUS-Liste herangezogen.

Potenziell inadäquate Medikation (PIM)
Als potenziell inadäquate Medikation (PIM) werden Wirkstoffe bezeichnet, die für ältere Menschen möglicherweise ungeeignet sind und vermieden werden sollten. Einen Überblick, welche Wirkstoffe darunterfallen, gibt seit dem Jahr 2010 die PRISCUS-Liste. Derzeit werden darauf 177 Wirkstoffe beziehungsweise Wirkstoffklassen geführt.
Die PRISCUS-Liste ist im Internet unter priscus2-0.de frei verfügbar. Sie ist allerdings nicht als generelle Negativ- oder Ausschlussliste zu verstehen. Je nach Indikation und Patient:in kann auch die Verordnung eines PIM sinnvoll und notwendig sein. Die Einschätzung, welche Medikation die geeignete ist, bleibt eine wichtige Aufgabe der behandelnden Ärztinnen und Ärzte.
Häufige unerwünschte Wirkungen
Bestimmte Wirkstoffe können bei älteren Menschen eher unerwünschte Wirkungen auslösen.
Beispiele dafür sind:

STÜRZE
- Herzrhythmusstörungen: Methyldigoxin
- Antidepressiva: Amitriptylin
- Anxiolytika, Hypnotika und Sedativa: Bromazepam
- Blutdrucksenker: Doxazosin
- Analgetika: Opioide (Tramadol, Piritramid)

VERWIRRUNG
- Herzrhythmusstörungen: Methyldigoxin, Sotalol
- Antidepressiva: Amitriptylin
- Anxiolytika, Hypnotika und Sedativa: Bromazepam
- Parkinsonmittel: Cabergolin

TROCKENER MUND
- Antidepressiva: Amitriptylin
- Herzrhythmusstörungen: Sotalol
- Psycholeptika: Haloperidol
- Blutdrucksenker: Doxazosin
- Blasenschwäche: Solifenacin

SCHWINDEL UND BENOMMENHEIT
- Blutdrucksenker: Doxazosin
- Antidepressiva: Amitryptilin, Paroxetin
- Anxiolytika, Hypnotika und Sedativa: Bromazepam
- Parkinsonmittel: Cabergolin
- Herzrhythmusstörungen: Sotalol, Flecainid
- NSAR: Etoricoxib
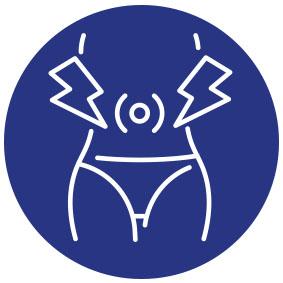
ÜBELKEIT, BAUCHSCHMERZEN, VERSTOPFUNG
- Herzrhythmusstörungen: Methyldigoxin, Sotalol, Flecainid
- Blutdrucksenker: Doxazosin
- NSAR: Etoricoxib
- Antidepressiva: Amitriptylin
- Blutzucker: Acarbose
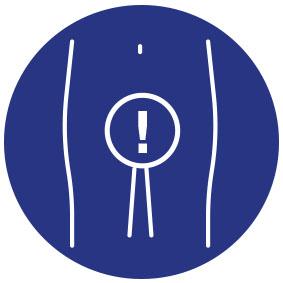
PROBLEME BEIM WASSERLASSEN, INKONTINENZ
- Antidepressiva: Amitriptylin, Maprotilin
- Blutdrucksenker: Doxazosin

SCHLAFSTÖRUNGEN
- Herzrhythmusstörungen: Methyldigoxin, Flecainid, Sotalol
- Antidepressiva: Tianeptin, Fluoxetin
VKI-TIPPS
- Nicht selbstständig absetzen: Auch wenn Sie den Wirkstoff eines vom Arzt verschriebenen Medikaments auf der Priscus-Liste entdecken, sollten Sie es niemals eigenmächtig absetzen. Suchen Sie möglichst zeitnah das Gespräch mit dem verschreibenden Arzt und besprechen Sie die weitere Vorgehensweise.
- Information: Achten Sie immer auf die Packungsbeilage des jeweiligen Medikaments. Suchen Sie, wenn Sie unsicher sind, wie Medikamente anzuwenden sind, immer die Unterstützung von Ärzt:innen und Apotheker:innen und erkundigen Sie sich nach Alternativen. Lassen Sie sich auch beim Kauf freiverkäuflicher Medikamente beraten. Im Rahmen der Medikationsanalyse in der öffentlichen Apotheke wird auch die Gesamtmedikation von Patient:innen fachlich und systematisch unter die Lupe genommen, um arzneimittelbezogene Probleme wie etwa Wechselwirkungen zu minimieren.
- Ärztlich abklären: Treten nach der Einnahme eines Medikaments unerwünschte Wirkungen auf, sollten Sie unbedingt und zeitnah mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin sprechen. Dies gilt besonders, wenn nach einem Medikamentenwechsel Symptome wie Schwindel, Benommenheit, Verwirrtheit, Verstopfung oder Mundtrockenheit auftreten.
- Medikationsplan erstellen: Erstellen Sie eine Liste (Medikationsplan) aller Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen, auch jene, die nicht ärztlich verordnet wurden. Notieren Sie auch die Dosis und wie oft die Einnahme erfolgt.
- Buchtipp: „Medikamente richtig anwenden“. Welches Präparat ist wofür geeignet? Wie sollte mit Arzneimitteln richtig umgegangen werden? Worauf kommt es bei Risiken und Nebenwirkungen an? Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter konsument.at/medikamente-anwenden









Kommentieren
Sie können den Text nach dem Abschicken nicht nachträglich bearbeiten, Länge: maximal 3000 Zeichen. Bitte beachten Sie auch unsere Netiquette-Regeln.
Neue Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern veröffentlicht werden.
Anmelden0 Kommentare