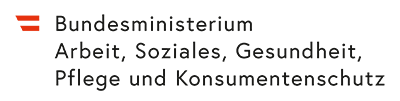Forschung: 100%, Vermarktung: 200%
Ohne Werbung läuft
in der Branche überhaupt nichts. Für die Vermarktung ihrer Produkte geben die
Firmen doppelt so viel aus wie für Forschung & Entwicklung. Die
Methoden sind vielfältig und gehen über Prospekte oder Inserate
in Fachzeitschriften weit hinaus. Ärzte erhalten regelmäßig Besuche von
Pharmavertretern, bei denen Geschenke und Gratisproben nicht fehlen dürfen.
In Belgien (mit Österreich vergleichbar) wird die Zahl der Vertreter auf
3500 geschätzt.
"Guten Tag Frau Doktor"
Eine britische Erhebung kommt zum Schluss, dass Ärzte so gut wie täglich mit
einem Vertreterbesuch rechnen müssen. Sie werden für ihre Mitarbeit an
klinischen Studien bezahlt, sie werden zu Weiterbildungskursen und Konferenzen
eingeladen, die von Pharmakonzernen organisiert werden, und das womöglich in
attraktiven Tourismusregionen. So ein bezahlter Urlaub kann (zumindest für Ärzte
aus der Dritten Welt) wertmäßig ein Viertel des Jahreseinkommens ausmachen.
Gratis-Medikamente der Kasse
verrechnet
Auch Gesetze und freiwillige Verhaltenskodizes können die Marketingpraktiken
der Pharmaindustrie nur zum Teil eindämmen. Aktuelles Beispiel: Im Sommer 2005
gingen in Österreich die Wellen hoch, als der Autor des Buches „Bittere Pillen“,
Hans Weiss, darauf hinwies, dass Ärzte mit Hausapotheke der Krankenkasse
Medikamente verrechneten, dies sie selbst als Gratisprobe bekommen hatten. Der
Gesetzgeber reagierte darauf mit einem Verbot für Naturalrabatte.
Geldrabatte bleiben erlaubt
Geldrabatte bleiben allerdings erlaubt, sofern sie die
„Geringfügigkeitsgrenze“ von 7500 Euro jährlich nicht übersteigen. Hans Weiss
hält das für Augenauswischerei, weil es niemand kontrollieren könne. „Wenn ich
das nicht an die Öffentlichkeit gebracht hätte, wäre überhaupt nichts passiert.“
Wyeth-Lederle verstieß gegen
Werbeverbot
Laienwerbung ist in Europa verboten. Die Bewerbung rezeptpflichtiger
Arzneimittel darf sich nur an Fachleute (Ärzte) richten. Trotzdem kommt es immer
wieder zu Übertretungen. Zuletzt – im Oktober 2005 – wurde der Firma
Wyeth-Lederle auf Betreiben des Vereins für Konsumenteninformation untersagt,
den Pneumokokken-Impfstoff im Internet zu verlosen.
GlaxoSmithKline: Panikmache um
Hepatitis
Eine beliebte Umgehung des Werbeverbotes stellen die so genannten „disease
awareness campaigns“ dar, also Aufklärungskampagnen, die Menschen vor schweren
Krankheiten warnen sollen. Solche Kampagnen werden oft von Pharmafirmen
finanziert, wenn es gilt ein neues Medikament zu vermarkten. In Österreich
verursachen vor allem Impfkampagnen immer wieder Aufsehen, weil sie mehr mit
Panikmache als mit Aufklärung zu tun haben. So die vor rund einem Jahr breit
publizierte Hepatitis-Kampagne, die von GlaxoSmithKline unterstützt wurde (siehe
„Konsument“ 6/2005, S. 10).
In diesem Bereich kann kein Unternehmen positiv hervorgehoben werden. Auch
Unternehmen, die sich sehr wortreich und detailfreudig zu ethischem Verhalten
verpflichten, sind ebenso häufig in Streitfälle verwickelt wie andere Firmen.
Mittel
gegen Schlafkrankheit: vom Markt genommen
Eflornithin, ein besonders wirksames und gut verträgliches Mittel gegen die
Schlafkrankheit, wurde 1985 zufällig im Rahmen der Krebsforschung entdeckt. Zehn
Jahre später wurde das Medikament von Hoechst Marion Roussel (heute
Sanofi-Aventis) vom Markt genommen, weil es nicht rentabel genug war. Fünf Jahre
danach kam der Konzern Bristol-Myers Squibb drauf, dass der Wirkstoff auch das
Haarwachstum hemmt, und brachte ihn als Creme gegen Damenbart wieder auf den
Markt.
Kein Geld für
Arme-Leute-Krankheiten
An diesem Beispiel, das BUKO Pharma 2004 veröffentlichte, wird das Verhältnis
der Pharmaindustrie zur Dritten Welt sichtbar. Für typische Krankheiten der
Dritten Welt wie Schlafkrankheit, Lepra, Tuberkulose oder Malaria werden kaum
Forschungsgelder investiert. Selbst wenn etwas durch Zufall entdeckt wird lohnt
es nicht, so ein Mittel anzubieten.
Viel Geld für Lifestyle-Krankheiten
Dagegen wird sehr viel Geld in die Erforschung von Mitteln gegen so genannte
Lifestyle-Krankheiten gesteckt, bei denen die potenziellen Käufer erst überzeugt
werden müssen, dass es sich überhaupt um eine Krankheit handelt, die
medikamentös zu behandeln ist (Mittel für oder gegen Haarwuchs, gegen Falten,
Schüchternheit oder Erektionsstörungen). Den größten Umsatz machen die
Pharmariesen mit Mitteln gegen hohen Blutdruck, hohe Blutfette, Arthritis,
Depression oder Allergien, und in diese Blockbuster („Kassenschlager“) wird
folgerichtig auch am meisten investiert. Dagegen werden in die „vernachlässigten
Krankheiten“ der Dritten Welt schätzungsweise nur 10 Prozent aller
Forschungsmittel gesteckt – jene Krankheiten, die für 90 Prozent der
krankheitsbedingten Todesfälle verantwortlich zeichnen.
AIDS: 39 Konzerne klagten
Südafrika
Dass öffentlicher Druck die Branche zum Einlenken zwingen kann, mag das
Beispiel Südafrikas belegen. Die südafrikanische Regierung wollte im Jahr 1997
die Produktion billiger AIDS-Medikamente ermöglichen und wurde daraufhin von 39
Pharmakonzernen geklagt. Die Berichterstattung darüber wirkte sich sehr negativ
auf das Image der Branche aus, sodass die Konzerne im Jahr 2001 beschlossen, die
Klage zurückzuziehen.
Zugeständnisse erst auf Druck
Welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen, die Situation in der Dritten Welt
zu verbessern? Vor allem müssten die Forschungsaktivitäten für „vernachlässigte“
Krankheiten erhöht werden, für lebenswichtige Medikamente wären Preisnachlässe
zu gewähren bzw. Lizenzen zu deren kostengünstiger Herstellung zu vergeben. In
Summe werden AstraZeneca, Glaxo und Novartis am besten bewertet, obwohl auch
diese Firmen teilweise erst auf öffentlichen Druck zu Zugeständnissen bereit
waren.
Umwelt
& Soziales: bestenfalls Durchschnitt
Umwelt-
und sozialgerechte Produktion, die bei Ethiktests üblicherweise die
bestimmenden Faktoren sind, haben in der Pharmabranche nicht dieses hohe
Gewicht. Die Herstellung von Medikamenten ist nicht sehr arbeitsintensiv, es werden eher
hoch qualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt. Probleme gibt es allerdings in den
vorgelagerten Stufen, in denen Rohstoffe verarbeitet (Erdölindustrie) bzw. die Wirkstoffe hergestellt
(Feinchemieindustrie) werden.
Gefährliche Produktion in Billigländer verlagert
Gefährliche und umweltbelastende Produktionsstufen werden häufig in
Niedriglohnländer ausgelagert. Die meisten Unternehmen scheuen sich, die
Verantwortung dafür zu übernehmen, sie erteilen den Zulieferbetrieben nur vage
Auflagen und verstecken sich lieber hinter den vor Ort geltenden Gesetzen. Damit
ist die Pharmabranche im Vergleich zu anderen Industriezweigen klar im
Rückstand. Vor allem bei den sozialen Kriterien verdient kein Unternehmen eine
positive Erwähnung.
Informationsoffenheit: Glaxo und Eli Lilly an
der Spitze
Im letzten Bewertungspunkt geht es um Informationsoffenheit. Werden auf der
Homepage des Unternehmens bzw. in Geschäftsberichten oder Ethik-Reports
ausführliche Informationen über die soziale Verantwortung geboten? Wie
bereitwillig werden Fragen der Erheber beantwortet? Nur zwei Konzerne ragen hier
aus dem Feld heraus: Glaxo und Eli Lilly, während vor allem Pfizer jegliche
Offenheit vermissen lässt.
US-Konzerne weit abgeschlagen
Alles in allem kann sich kein Pharmaunternehmen als Pionier in Sachen Ethik
fühlen. Selbst der Schweizer Konzern Roche, der das Ranking mit deutlichem
Abstand anführt, kann nur mit einem durchschnittlichem Ergebnis aufwarten (63
Prozent der möglichen Punkte erreicht). Etwas überraschen mag der zweite und
dritte Platz für die relativ kleinen dänischen Branchenvertreter Nycomed und
Novo Nordisk. Sämtliche US-Konzerne landen dagegen im geschlagenen Feld.